12. Februar 2019
Den Zweifel nähren
Der folgende Text ist eine überarbeitete Fassung meines Inputs auf einem Workshop für Cis-Männer („Im Zweifel für den Zweifel – Theatral-spielerische Reflexionen zu Männlichkeit“), den ich mit zwei Kollegen im Februar 2017 und erneut im September 2018 angeboten habe. Nach drei Tagen intensiver Auseinandersetzung mit Männlichkeit habe ich mit meiner eigenen Auseinandersetzung zu dem Thema den Raum für ein Abschlussgespräch geöffnet. Meine Worte waren ein Angebot an die Teilnehmer, über verschiedene Dinge noch mal ins Gespräch zu kommen. Ich fasse zentrale Punkte zusammen, die mich im Hinblick auf Männlichkeit bis heute beschäftigen in der Annahme, dass diese Gedanken auch für andere interessant sind.
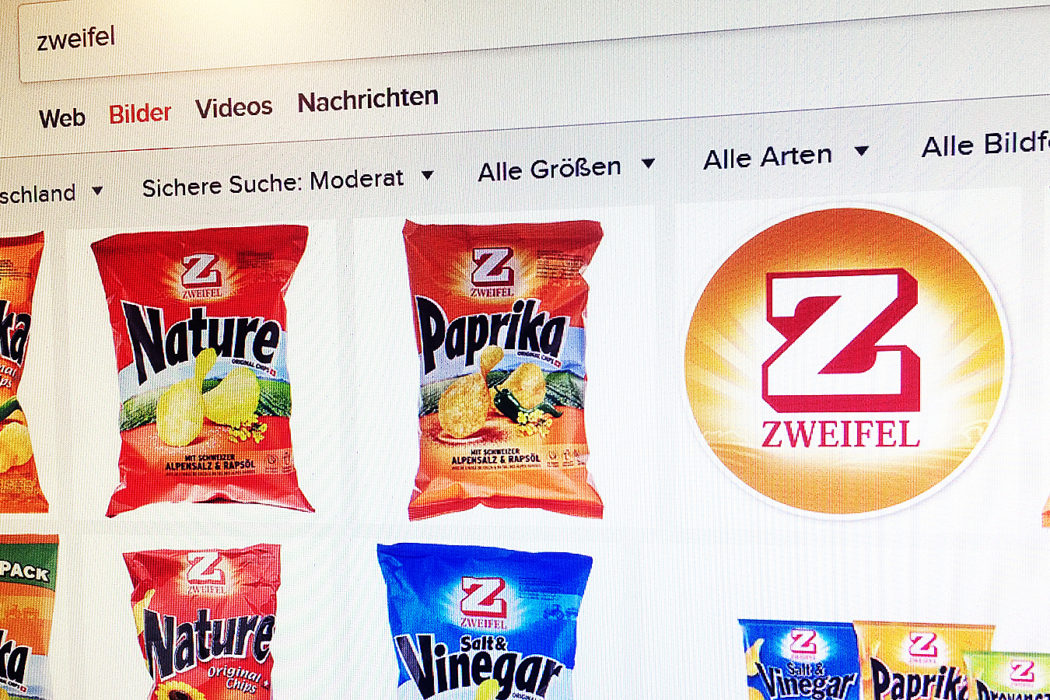
Politisierung
Politisiert habe ich mich Mitte der 1990er Jahre über eine Strömung innerhalb des Hardcore, genauer genommen des Emocore, der interessanterweise als Emo-Subkultur Jahrzehnte später ein Revival hatte. Stark beeinflusst durch Riot Grrrl und Feminismus wurden im Hardcore auch Geschlechterfragen verhandelt. Insbesondere ein Gedicht aus dem Booklet einer LP der Band Struggle hat mich sehr stark geprägt: A Poem For Men Who Don‘t Understand When We Say They Have It („Ein Gedicht für Männer, die nicht verstehen, wenn wir sagen, dass sie es haben“). Der_die anonym bleibende Autor_in schreibt aus einer weiblichen Sicht über männliche Privilegien und richtet sich an Cis-Männer. Die Zeile „Privilege means someone else’s pain“ („Privilegien bedeuten anderer Leute Schmerz“) hat mich besonders beschäftigt. Mich hat der Gedanke nicht losgelassen, dass jemand anderes leidet, weil ich privilegiert/männlich bin.
Etwas später entdeckte ich den Männerrundbrief, das zentrale Verständigungsorgan der autonomen, profeministischen Cis-Männer-Szene im deutschsprachigen Raum von 1993–2002. Der Männerrundbrief propagierte die „Abschaffung von Männlichkeit“. Das Argument war so einfach wie bestechend: Männlichkeit braucht man nicht, um glücklich zu sein.
Inhaltlich stimme ich dem zu: Die Herausbildung kollektiver Identitäten, beispielsweise „der Männer“ und „der Frauen“, ist ein Prozess, der willkürlich Grenzen errichtet. Nach innen wird homogenisiert – „Männer sind sportlich / stark / kommunikationsunfähig / haben Bewegungsdrang / sehen den Schmutz einfach nicht / können räumlich denken / Bier / Fußball“ etc. – und nach außen wird ausgeschlossen: all das und diejenigen, die nicht „männlich“ sind, also Frauen*, Trans*, Inter* und diejenigen Eigenschaften und Fähigkeiten, die „weiblich“ belegt sind. Ich verstehe vor diesem Hintergrund „Männlichkeit“ einerseits als kulturelle Bilderwelt, die vorgibt, wie „Männer“ sein sollen und andererseits als Set von Verhaltensmustern, das daraus entsteht.
Selbsthass
Demzufolge war Männlichkeit für mich negativ bewertet. Das hatte Auswirkungen auf meine politische Entwicklung und mich ganz persönlich. 2005 habe ich ein paar Gedanken hierzu festgehalten:
„Es fällt mir oft schwer, mit meiner privilegierten Position umzugehen. Ich lehne beispielsweise so etwas wie Männlichkeit, Weiß-Sein, etc. grundsätzlich ab, also in einer befreiten Gesellschaft wird es so etwas nicht mehr geben. Genau diese Kategorien verkörper‘ ich jedoch; ich bin durch und durch privilegiert, will aber genau diese Privilegien abschaffen. Das führt zu einem Widerspruch in mir als Person. Ich weiß zwar, dass dieser Widerspruch ein gesellschaftlicher ist, der sich demnach eben auch in mir widerspiegelt – dennoch bin ich deswegen manchmal richtig verzweifelt und habe eine spezifische Form von Selbsthass, wo ich mich nicht mehr gut annehmen kann.
Es gibt in mir den Wunsch, so sein zu dürfen, wie ich bin und so auch geliebt zu werden. Und andererseits gibt es in mir den Wunsch, mich zu verändern, und zwar in eine Richtung, dass es so jemanden wie mich (auf einer gesellschaftlichen Ebene) gerade nicht mehr gibt. Anders formuliert: Ich möchte eine soziale Revolution. Und bis dahin möchte ich die eben skizzierten Widersprüche wenigstens aushalten können. Und ich will auch sagen können, dass es mir mit meiner privilegierten Position, meiner Männlichkeit, meiner Heterosexualität, meinem Weiß-Sein, etc. manchmal schlecht geht und ich genau darunter leide. Das fällt mir oft schwer.“
Ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Gefühlen und Gedanken nicht alleine bin. Ich kenne gerade aus linken Cis-Männerkreisen die Tendenz von einigen, sich mit allem sehr zurückzuhalten, um auf gar keinen Fall als irgendwie dominant zu erscheinen. So gibt es bei einigen die Tendenz, sich unsichtbar zu machen, beispielsweise gar nichts zu sagen oder nur mit ganz leiser Stimme zu sprechen. Hinter einem solchen Verhalten kann – nicht muss – auch eine Form von Selbsthass und sich nicht annehmen können stehen. Ich denke, dass das eine ganz typische Dynamik bei Privilegierten ist, die sich kritisch mit ihren Privilegien auseinandersetzen.
„Selbsthass“ ist ein großes Wort, und die Passage von 2005 könnte sich so lesen, als sei der Feminismus am Selbsthass einiger Cis-Männer schuld. Ich gehe hingegen davon aus, dass sich (leider) sehr viele Menschen selbst abwerten und dass dies grundlegende Ursachen in Gesellschaft und Psyche hat. Mit „Selbsthass“ meine ich Dinge, die eine_n klein halten. Scham kann ein Anzeichen dafür sein. Fast jede Therapierichtung hat ihre eigenen Begriffe (Schweine/Dämonen/Schatten/core limiting beliefs/Stimmen/innere Kritiker_innen, …) dafür, aber sie kommen in fast allen vor.
Schuld ist natürlich nicht der Feminismus – auch wenn es für Cis-Männer sicherlich ein anderes Spannungsverhältnis als für Frauen* gibt – oder die Auseinandersetzung mit Herrschaft. Der Selbsthass geht dem voraus und speist sich aus anderen Quellen, beispielsweise einem Scheitern an Idealen oder Erwartungshaltungen, der Anpassung an Normen, Bindungsabbrüchen oder der verinnerlichten Botschaft, nur über Leistung liebenswert zu sein und nicht so, wie man ist. Ich habe mir lediglich eine bestimmte Theoretisierung und in dieser eine bestimmte Lesart gesucht.
Ich finde dies bis heute eine spannende und absolut relevante Frage: Warum suche ich mir welche Art von Theorie/Theoretisierung? Was hat das mit meiner psychischen Verfasstheit zu tun?
Unabhängig von der Theorie, die man(n) sich für sein eigenes Leben sucht, bringen die beschriebenen Dynamiken ein doppeltes Problem hervor. Einerseits geht es diesen Männern nicht gut, weil bestimmte eigene Bedürfnisse tendenziell verleugnet werden, sobald sie als „typisch männlich“ wahrgenommen werden: laut sein, Ballerspiele, Gangsta-Rap, Missionarsstellung, schnelle Autos etc. Andererseits erfolgt häufig eine ausschließliche Orientierung an dem, was Frauen* bzw. Feministinnen wollen. Meine Arbeitskollegin hat treffenderweise mal gesagt, dass das immer so anstrengende Männer sind, weil sie alle Verantwortung und Entscheidungen Frauen* aufbürden und in ihrer eigenen Unsicherheit verharren.
Fragen
Besagte Kollegin war es auch, die mir sagte, dass die Dinge, die gesellschaftlich als „männlich“ wahrgenommen und vermittelt werden, doch auch total viele positive Seiten und Aspekte haben, die allen zugänglich gemacht werden sollten. Also so etwas wie Durchsetzungsfähigkeit, Abgrenzungsfähigkeit, Interessenvertretung gegenüber Autoritäten, konfrontativ sein dürfen statt immer harmonisch, Aggressionen nach außen lenken können statt selbstschädigend nach innen – das ist nicht immer schlecht. Das zu hören hatte für mich etwas Beruhigendes.
Ich führe mit einem Freund von mir seit vielen Jahren Gespräche über Männlichkeit und die „Männerbewegung“, u.a. auch über die Frage, warum die „Männerbewegung“, die fast immer eine implizit heterosexuelle (und cisgeschlechtliche) war, und die linke Schwulenbewegung fast nie zusammen gekommen sind. Mein Freund begreift Männlichkeit auch als konstruiert, möchte diese aber dennoch nicht abschaffen; zum einen, weil er glaubt, dass das nicht geht, zum anderen, weil er Männlichkeit per se auch nicht schlecht findet.
Seine und die Ansichten benannter Kollegin haben bei mir viel verändert; ebenso die Erkenntnis, dass konkrete Männer* nicht identisch sind mit „Männlichkeit“.
Meine Negativbewertung von früher ist heute einer fragenden Haltung gewichen:
Geht es beim Streben nach einer freien und gerechten Welt um die Demontage von Männlichkeit? Ist das ein Ziel? Soll Männlichkeit abgeschafft werden?
Oder hat Männlichkeit auch positive Aspekte, die für alle Menschen wichtig sein könnten? Sollten positive Bilder davon entworfen werden, wie Männlichkeit sein könnte, wenn sie als individuelle Wahl und gestaltbar verstanden würde? Die Frage wäre dann: Wie können die positiven Seiten von Männlichkeits(- und Weiblichkeits)mustern allen Geschlechtern zugänglich gemacht werden?
Oder geht es um die Entkopplung menschlicher Eigenschaften von der Zuschreibung als „männlich“, um eine Entgeschlechtlichung? Und wenn ja, wie geht das?
Veränderung
Die drei skizzierten Strategien – abschaffen, ressourcenorientiertes Aneignen, entgeschlechtlichen – sind nicht per se unterschiedlich, sondern können Aspekte eines Prozesses der Aufhebung von Geschlecht sein. Dieser Prozess ist individuell nicht möglich, sondern nur durch eine kollektive Bewegung, die positive Bilder von Männlichkeit entwickelt, um sie direkt danach wieder zu dekonstruieren, um anschließend Männlichkeit neu zu erfinden und dann wieder zu verwerfen usw. Eine Bewegung also, die sich fragend bewegt und die im Zweifel für den Zweifel ist, die also Männlichkeit niemals als etwas in Stein Gemeißeltes versteht und das Unabgeschlossene, Uneindeutige und Widersprüchliche wertschätzt. Durch dieses Vorgehen würde das Verhältnis von Identität und Vergeschlechtlichung stets offen und beweglich gehalten. Dadurch würden die oben erwähnten Prozesse der Errichtung von Grenzen und damit einhergehende Verengungen unterlaufen.
Rechte
Mich beschäftigt auch die Frage, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen? Warum sollte ich das tun, was sind (mögliche) Gewinne? Cis-Männer könnten ja auch einfach sagen: „Interessiert mich nicht“, und oft genug passiert gerade das. Auch linke Cis-Männer vermeiden häufig die Beschäftigung, weil sie kompliziert und widersprüchlich ist, und so kommt es zur erfolgreichen Politisierung der Geschlechterfrage von Rechts ohne nennenswert wahrnehmbare Kritik von emanzipatorischer Seite.
Um ein Beispiel hierfür zu nennen: Die Diskussion um „Jungen als Bildungsverlierer“ ist auf vielen Ebenen schlichtweg falsch. Wer tatsächlich Jungen* unterstützen möchte, erreicht dies nicht durch die einseitige Dramatisierung von Geschlecht – „mehr männliches Lehrpersonal, Toberäume für Jungen*, traditionell männliche Angebote für Jungen*“ –, sondern in der Wahrnehmung der Unterschiedlichkeit von Jungen* und daraus abgeleitet vielseitigen Angeboten und einem diversen pädagogischen Team.
Wer wie Männerrechtler/Maskulisten versucht, die mit Männlichkeit einhergehenden Widersprüche in Form von identitätspolitischer Interessenvertretung aufzulösen, richtet dabei viel Schaden bei anderen (allen, die nicht „männlich“ genug sind) und nicht zuletzt auch sich selbst an (ein noch stärkerer Druck für Jungen*/Männer*, „männlich“ zu sein).
Gewinne
Ich würde sagen, sich all das anzueignen, was als „richtiger Mann“ nicht gelebt werden darf – von tiefen Freundschaften, Körperkontakt, sich Hilfe holen, Weichheit, weinen, körperliche und psychische Selbstsorge, Schminke und der Ablehnung von Leistung und Arbeit – ist extrem befreiend auf einer individuellen Ebene. Ein deutlicher Gewinn ist auch, sich von Männlichkeitsanforderungen wie kämpfen, konkurrieren und gewinnen müssen, überlegen und immer souverän sein, immer Sex wollen und immer können zu müssen, nicht homosexuell zu sein, erfolgreich im Beruf, Sachen reparieren können etc. loszusagen. Weitere Motivationen neben vielen weiteren, vorherrschende Männlichkeitsideale ad acta zu legen, kann der Wunsch nach einer erfüllten Liebesbeziehung sein oder auch der Kampf gegen Ungerechtigkeit und Solidarität mit Diskriminierten. Gerade Letzteres ist für mich schon immer eine ganz zentrale Triebkraft gewesen.
Sanktionen
Die individuelle Loslösung von Männlichkeitsnormen kann zugleich negative Folgen auf einer gesellschaftlichen Ebene haben: Alles, was „zu weit“ von der Männlichkeitsnorm abweicht, wird sanktioniert: mit Gewalt, Isolation und ganz realem Macht- und Privilegienverlust. „Schwul“ ist für Heranwachsende immer noch das Disziplinierungsmittel Nummer eins in Sachen Männlichkeit, und wer die „falsche“ Performance als Mann hat und die Umfelder irritiert reagieren, spürt die Barrieren in dieser Gesellschaft recht schnell.
Persönliche Beispiele, drei von unendlich vielen:
* In meiner Arbeit mit Jungen* in Berlin-Marzahn hatte ich beim Sitzen die Beine übereinander geschlagen. Sofort wurde ich gefragt, ob ich „schwul“ sei. Für diese Jungen war klar, dass kein „richtiger“ Mann so dasitzt.
* Mein Perlenarmband zieht immer wieder beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich, teilweise sind ganze Gruppen darauf fokussiert und ich werde sehr häufig darauf angesprochen. Es kam auch schon vor, dass wildfremde Leute einfach daran gezogen haben.
* Und dann jemand, der sich ständig so viel mit Geschlecht beschäftigt und dann auch noch Gender Studies studiert hat – „Bist du schwul?“ „Hast du ein Problem mit deiner Männlichkeit?“ Auf jeden Fall bin ich irgendwie verdächtig. Aber auch interessant, wie das Paar fand, das mich als Tramper 400 Kilometer mitnahm und mich unablässig fragte, ob man mit meinem Studium auch Paarprobleme bearbeiten könne…
Die Alltäglichkeit dieser symbolischen Grenzen, Gebote, Verbote, Normierungen und Nahelegungen sind die Basis für Gewalt. Deswegen gibt es bei vielen Cis-Männern eine große, durchaus berechtigte Angst, Schritte in Richtungen zu gehen, die „abweichen“. Das ist, denke ich, einer der zentralen Gründe dafür, warum emanzipatorische Männerbewegungen immer schon lächerlich klein waren. Ein weiteres Beispiel: In der sechsten Klasse fiel ein Mitschüler von mir beim Fußballspielen aufs Knie und weinte. Ich habe ihn getröstet und ihm dabei über den Kopf gestreichelt. Alle Jungs*, inklusive ihm, lachten mich aus. Ich habe die Nachhilfe in Sachen männlicher Sozialisation verstanden und fortan fürsorglichen Körperkontakt mit männlichen Mitschülern eher vermieden.
Einsamkeit
Vorherrschende Männlichkeitsnormen abzulehnen kann auch heißen, einsam zu sein beziehungsweise zu werden. Man verlässt ein Stück weit die Gruppe der Cis-Männer, fühlt sich dort zunehmend unwohler, man ist aber auch nicht Frau*, Trans* oder Inter*. Das kann zu einer ganz spezifischen Form von Einsamkeit führen. Ich verstehe die „Schwindelgefühle“, von der die Soziologin Raewyn Connell in ihrem Standardwerk Der gemachte Mann an verschiedener Stelle spricht und die bei einer „Politik des Austritts“ aus dem System hegemonialer Männlichkeit zutage gefördert werden können, auch in diese Richtung.
Ein wichtiges Buch für mich ist White Men Challenging Racism („Weiße Männer gegen Rassismus“). Es besteht aus Interviews mit weißen Cis-Männern, die sich gegen Rassismus engagieren. Viele von ihnen beschreiben genau diese Einsamkeit, und dass es für sie wichtig ist, andere weiße Männer*, die gegen Rassismus und Sexismus kämpfen, zu kennen. Es geht hierbei nicht um die Selbstversicherung als weiße Männer*, sondern um einen Austausch über spezifische Problemlagen, eine Auseinandersetzung mit Schuld und Scham, um ein gemeinsames Lernen ohne dafür Frauen* und/oder People of Color dafür einzuspannen und nicht zuletzt geht es um Handlungsfähigkeit. Kollektiv-solidarische Räume können vor diesem Hintergrund nicht nur der Einsamkeit ein Schnippchen schlagen, sondern auch dem Schwindel.
Widerstände
Die Auseinandersetzung mit Privilegien und eigener Täterschaft kann schmerzhaft sein, in der Radikalen Therapie – einem selbstorganisierten, gruppentherapeutischen Ansatz, der von seiner Geschichte her in geschlechtshomogenen Gruppen entwickelt wurde – spricht man hier von „Täterschmerz“. Das Lernen über Geschlecht und über Männlichkeit sowie die Auseinandersetzung darüber wird in aller Regel von vielen Widerständen begleitet. Dies ist wenig verwunderlich, da unser Verständnis von Männlichkeit/Weiblichkeit/Geschlecht immer auch sehr viel mit uns selbst zu tun hat. Es ist ein anderes Lernen als beispielsweise die Aneignung der Funktionen einer neuen App.
In der Kritischen Psychologie wird davon ausgegangen, dass Lernen über Widerstände und Krisen stattfindet; die feministische Erziehungswissenschaftlerin Judith Krämer zeigt dies in ihrer Studie Lernen über Geschlecht empirisch anhand von Lernprozessen zu Geschlechterverhältnissen.
Ein typischer Widerstand von Cis-Männern kann zum Beispiel so aussehen, dass sie sich ganz viel mit Butler & Co. beschäftigen, also mit viel (Geschlechter-)Theorie, nicht aber mit ihren eigenen Gefühlen, Psychos und Körpern. Diese Form der Rationalisierung und des Bedürfnisses nach Kontrolle ist meiner Erfahrung nach in linken Kontexten in aller Regel noch ausgeprägter als in der Mainstreamgesellschaft.
Der Widerstand kann bei männerbewegten Cis-Männern auch genau anders herum aussehen: Es wird ganz viel gespürt, aber jegliche Form von Einordnung, Ins-Verhältnis-Zu-Anderen-Setzen und Theorie wird abgelehnt. Die Devise lautet: „Weniger reden, mehr spüren“. Insbesondere Weinen kann implizit zu so einer Art Königsdisziplin werden; Weinen in der (Cis-)Männergruppe – dann hat man(n) es geschafft. (Aus eigener Erfahrung würde ich allerdings sagen, dass die eigentliche Königsdisziplin in linken Cis-Männergruppen die Arbeit mit Wut und Aggression ist – in aller Regel gibt es hiervor sehr viel Angst und Abwehr.) Im Ergebnis wird sich nur auf sich selbst bezogen. Männliche Herrschaft wird dadurch stabilisiert, da alle anderen Geschlechter mit ihren Interessen und Bedürfnissen nicht mehr gleichrangig vorkommen.
Von daher soll dieser Beitrag auch eine Einladung an Cis-Männer sein, sich mit den eigenen Widerständen beim Hinterfragen von Männlichkeitsidealen kritisch zu befassen, sie ernst zu nehmen, sie wertzuschätzen und sie sich genauer anzugucken. Wie sahen meine eigenen Lernprozesse zu Männlichkeit aus, was waren zentrale Themen, was waren wichtige Ereignisse, wann gab es Zweifel und wo habe ich Widerstand wahrgenommen? Und kann ich daraus eventuell anderen, die am Anfang dieser Auseinandersetzung stehen, etwas mitgeben? Was hätte ich gerne von Anfang an gewusst, das mir die Auseinandersetzung erleichtert hätte?
(Cis-)Männergruppe
By the way (Cis-)Männergruppe: Häufig Gegenstand von Spott, halte ich sie trotz des Wissens um queer und Geschlechterdekonstruktion für eine wichtige Einrichtung. Frauen*, Trans* und Inter* kann die Arbeit der Erklärbär_innen abgenommen werden und sie werden potenziell verletzenden Aussagen nicht ausgesetzt, wenn sich Cis-Männer untereinander kritisch mit dem Geschlechterverhältnis auseinandersetzen.
Die (Cis-)Männergruppe kann allerdings auch zum Problem werden, nämlich dann, wenn dort Sachen gesagt und gezeigt werden, die sich Cis-Männer in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe nicht zu sagen/zeigen trauen, aus Furcht vor Kritik von und Ablehnung durch Frauen*. Werden diese als Störfaktor wahrgenommen, der Sicherheit wegnimmt, dürfte es sich in aller Regel um einen Cis-Männerbund von links handeln, der das macht, was Cis-Männerbünde seit eh und je machen: Frauen* ausschließen. Die vieldiskutierte Frage, was eine emanzipatorische (Cis-)Männergruppe ausmacht, wird in diesem lesenswerten Text ausführlicher behandelt.
Persönlich gesprochen habe ich viel in (Cis-)Männergruppen und durch andere Männer* gelernt. Insbesondere MRT (Männer Radikale Therapie) war wichtig für mich: Gegen den im ersten Teil angesprochenen Selbsthass habe ich gelernt, mir Selbstwertschätzung zu geben, ich habe gelernt, andere zu unterstützen und ganz allgemein mehr in Beziehung zu mir und anderen zu treten. Und ich habe u.a. mit Jungen*arbeit und verschiedenen Formen von Körperarbeit und Tanz angefangen.
In meiner Auseinandersetzung mit Männlichkeit waren ebenso Frauen* absolut zentral, und ich weiß, dass ganz allgemein viele Cis-Männer in ihrer Auseinandersetzung mit Männlichkeit von Frauen* unterstützt wurden und werden. Hierfür empfinde ich große Dankbarkeit.
Andreas Hechler ist die Diskussion um „toxische Männlichkeit“ aufgrund ihrer impliziten Konstruktion einer ‚guten Männlichkeit‘ häufig suspekt. Ihn interessiert die Verbindung der kleinen mit den ganz großen Fragen, das Individuum und die Gesellschaft, der Alltag und die Herrschaft, die Therapie und die Revolution, die Psyche und die Macht. Gelegentlich legt er als DJ lila Pudel auf.
Zurück